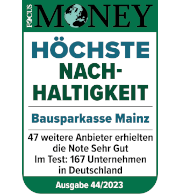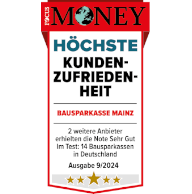Wo du auch im Leben stehst: Mit uns erreichst du deine Ziele und entwickelst sichere, klar strukturierte Pläne für deine finanzielle Zukunft.
Wir stehen an deiner Seite.
Geh den ersten Schritt. Was sind deine Ziele?
Wir sind ausgezeichnet. Mit Sicherheit.

Deine Bausparkasse
Bei uns findest du nicht nur tolle Konditionen und vielfältige Produkte, sondern auch jemanden, der dir wirklich zuhört. Wir sind für dich da – ansprechbar, persönlich und direkt. Wir finden Lösungen, die Großes möglich machen und zu deinem Leben passen.
Überzeuge dich selbst!
Infos für dich – Unser BKM Ratgeber

Wärmepumpen in BestandsimmobilienKosten, Vorteile und Förderungen
Die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen in älteren Wohngebäuden kann dank moderner Technologie...

Die neue Arbeitnehmersparzulage:Das solltest du jetzt wissen
Die Arbeitnehmersparzulage ist eine staatliche Förderung mit der die Vermögensbildung von Arbeitnehmenden un...

Die richtige Fassadendämmung wählen:Kosten und Vor- und Nachteile im Überblick
Für die Fassadendämmung stehen die unterschiedlichsten Systeme zur Verfügung. Hier erfährst du, welche Var...
Die häufigsten Fragen schnell geklärt
Wie kann ich meine persönlichen Daten ändern?
Das geht ganz einfach online. Unter dem Reiter Kontakt & Anträge findest du alle Self-Services.
Kann ich meine Konten online führen?
Ja, über unser Kundenportal hast du rund um die Uhr Zugriff auf deine Konten. Du hast immer den aktuellen Überblick, kannst von deinem Tagesgeldkonto Auszahlungen vornehmen und dir stehen diverse Servicefunktionen zur Verfügung. Hier kannst du dich ganz einfach registrieren.
Welche Konditionen bietet die BKM bei Finanzierungen an?
Diese Frage kann so pauschal nicht beantwortet werden. Bei der Vergabe von Krediten spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Wir berücksichtigen alle, einzeln und im Zusammenspiel. Wir sprechen mit dir und klären deine Wünsche und Möglichkeiten. Erst dann steht fest, welches Finanzierungsprodukt zu dir passt. Über unsere Beratersuche kannst du schnell und einfach die passende Unterstützung finden.
Welche Geldanlagen gibt es bei der BKM?
Diese Geldanlage-Produkte bieten wir dir mit Online-Abschluss an:
Tagesgeld, Festgeld, Festgeld mit Nachrangabrede, Sparbrief, Entnahmeplan, Zuwachssparen.
Details zu den Produkten findest du hier.
Wie bekomme ich Unterstützung bei einer energetischen Sanierung?
Super, dass du dich darum kümmerst, denn der Zeitpunkt war nie besser als jetzt. Unsere Berater und Beraterinnen unterstützen dich gerne und zeigen dir günstige Finanzierungsoptionen auf. Über unsere Beratersuche kannst du dir direkt deine persönliche Ansprechperson heraussuchen. Du kannst uns aber auch über das Kontaktformular erreichen.
Bereit für eine neue Zukunft?
Deine Karriere bei der BKM
Neue Schritte, neue Wege, neue Zukunft – und du bist mittendrin! Auf unserer Karriereseite kannst du dich auf unsere offenen Stellen bewerben oder eine Initiativbewerbung einreichen. Melde dich bei uns!

Jetzt Newsletter abonnieren und exklusive Vorteile sichern!
Bleib immer auf dem Laufenden! Melde dich einfach für unseren Newsletter an und profitiere von tollen Angeboten sowie von wertvollen Tipps rund um Sparen, Finanzieren, Bauen, Vorsorge und Geldanlage.